Florida Boy

Frankfurter Jungs

Es ist still um mich herum. So still, dass mein Magen sich nicht traut, ein Knurren von sich zu geben, obwohl der Hunger unüberhörbar in mir schreit – wahrscheinlich aus Höflichkeit der Stille gegenüber.
Irgendwann wird sie laut, diese Stille, so laut, dass es in meinen Ohren dröhnt. Niemand ist hier, nichts macht Geräusche, nichts piept, nichts brummt, nichts beschwert sich, nichts summt. Es ist einfach still und eigentlich bin ich froh, dass es so ist, ist es doch das, was ich mir gewünscht habe, all die letzten Tage. Aber ich habe scheinbar einfach vergessen, wie anstrengend die Stille ist, wenn man den Lärm gewohnt war.
Es ist gesund, mache ich mir bewusst, es ist gut für den Körper, wenn es auch die Seele quält. Die Ohren erholen sich, wenn sie fertig gedröhnt haben. Der Kopf wird sich schon anpassen und leise werden, irgendwann. Aber die Zeit dehnt sich wie ein längst geschmackloser Kaugummi, den man aus irgendeinem Grund trotzdem weiterkaut, bis er beginnt sich aufzulösen.
Die Tasse vor mir ist weiß und leer und obwohl keine Augen darauf sind, starrt sie mich an, als würde sie mir wortlos mitteilen, dass ich auf mich alleine gestellt bin. Ich wusste gar nicht, das augenlose Dinge starren können, aber diese Tasse tut es, eindeutig. Was würde sie mir an den Kopf werfen, wenn sie tatsächlich reden könnte? Sich selbst vielleicht? Oder würde sie mich darauf hinweisen, dass meine Augenringe mir schon unter meinem Arsch hängen? Vielleicht würde sie auch den Pickel kommentieren, der sich mein Gesicht als neuen Wohnort ausgesucht hat, seitdem ich aufgehört habe, auf meine Ernährung zu achten. Eins ist klar, Nettigkeiten sind nicht ihr Ding, so wie sie da steht: elegant, in weiß gekleidet, edle Kurven. Plötzlich fallen mir die Kaffeeflecken auf: eine Tasse mit Kaffee-Patina – sympathisch irgendwie. Vielleicht liegt es daran, dass wir uns so ähnlich sind. Von außen halbwegs ordentlich, innen eine kleine Katastrophe. In mir ist nun so lange schon nicht aufgeräumt worden, ich will nicht wissen, wie hässlich es dort aussieht. Die Türe dorthin bleibt schön geschlossen. Die Tür hier vor mir steht kerzengrade im Raum, in knalligem Gelb, blauer Griff. So selbstbewusst, so kerzengerade. Bestimmt der Typ, der dir auf die Schulter packt und sagt „Alles wird schon gut am Ende, aber erst einmal musst du da durch. Ich mach’s nicht für dich und auch niemand sonst.“ Sie wäre auch der Freund, der in jeder Bar nicht nur direkt den besten Platz, sondern zehn neue Bekannte findet, einfach so, weil er eben er ist. Ich bin sicher, sie wäre ein toller Freund. Tiefe, ruhige Stimme, trockener Humor, sicher, stark. Ich umarme keine Bäume und auch keine Türen, aber diese Tür sieht so aus, als könnte man sie super umarmen. Man würde sich sicher geborgener und gehaltener fühlen, als bei einigen Genossen im eigenen Umfeld. Traurig.
Traurig ist hier alles. Mein Rucksack? Sieht aus, als hätte er drei Nächte durchgefeiert und danach beschlossen, ein Dasein als trauernde Fledermaus zu führen. Erledigt, aber loyal. Halb offen, aber nicht die Kraft, etwas zu offenbaren. Innen sowieso leer. Hätte er eine Stimme, wäre sie dünn und niedergeschlagen oder dunkel, tief und monoton.
Plötzlich freue ich mich doch über die Stille. Irgendwie ist sie doch gar nicht so schlecht – zumindest besser als ein Gespräch mit dem deprimierten Rucksack. Und wer weiß, vielleicht brauche ich diese Ruhe ja doch.
Vanessa Verzay
Mein Rauch ist besser
Reportage von der Inter Tabak lesen auf textor.online
Glücksache Logik
Eine Gesprächsrunde von Freundinnen war neulich bei einer Witwe eingeladen, deren Trauerfall zwei Jahre zurückliegt. Wovon die Gastgeberin erzählte, war nicht mehr ihr Mann und der Verlust desselben; davon hatte sie im ersten Jahr ihrer Witwenschaft so ausführlich gesprochen, dass es vorerst gut war damit, soll heißen: Neues ließ sich da nicht mehr sagen. Stattdessen erzählte sie den Freundinnen von dem gemeinsamen Bankkonto, das ihr Mann und sie unterhalten hätten, noch bis vor zwei Wochen. Es sei ihr zwei Jahre lang nicht gelungen das Konto aufzulösen und die längste Zeit sei ihr auf dem Konto überhaupt nichts gelungen, keine einzige Transaktion.
Gebannt hörten die Freundinnen der Witwe zu. Das Konto schien eine Verbindung zwischen den Eheleuten gestiftet zu haben, die fester hielt als das Leben. Mehr lesen
balkannachklang
Ewart Reder
Badende

In der Fremde
Wenn ich in meinem Belgrader Kiez einen Laden betrete, erwidern die allermeisten Angestellten meinen Gruß. Es sei denn (Klassiker meiner Jugendzeit), ich wünsche der Bäckerin um vierzehn Uhr einen „guten Morgen“. Sonst, bei korrektem Gebrauch der drei tageszeitlichen Spezialbegrüßungen, habe ich eine fast hundertprozentige Antwortquote. Das ändert sich, wenn ich das Geschäft verlasse. Kaum eine Verkäuferin von zehn presst sich ein noch hörbares „Auf Wiedersehen“ ab, nachdem ich dasselbe laut und deutlich gewünscht habe. Die anderen neunzig Prozent sagen kein einziges Wort, wenn ich gehe. Woran liegt das? frage ich mich als Mensch, der zeitlebens wissen will, warum Dinge geschehen oder nicht geschehen. Mehr lesen
Bluz’n Pivo
Mittwoch, 2. Otober 2024, 15 – 16 Uhr
WortWellen – Anhören bei music-society.de
„Bluz’n Pivo“ alias „Blues’n Beer“ heißt eine Livemusik-Kneipe auf der Cetinjska ulica in Belgrad. Aus dieser Kneipe, genauer von einem Blues-Rock-Konzert des Bassisten Nikola Marković und seiner Band stammt die Musik der Sendung. Den musikalischen Nachschlag gibts von der Nachbarstraße, der berühmten Skadarska, die ich mit meinem Aufnahmegerät für euch runtergeschlendert bin vom Festungsberg bis zum Marktplatz, an einem Samstagabend, als in jedem der unzähligen Straßenrestaurants Live-Musik im Original Balkanstyle ertönte. Zwischendurch erzähle ich euch Geschichten von traurig bis lustig aus dem Belgrad, das ich diesen Sommer ausführlich erlebt habe. Herzliche Einladung eures WortWellenschlägers Ewart Reder.

Der Frustrator
Die Belgrader Straße, in der ich wohne, hat viele dominante Bewohner. Man fragt sich, wen all die Alphawesen überhaupt dominieren wollen. Es müssten Wesen ohne eigene Dominanz sein und die sind in der Straße selten. Autofahrer preschen dieselbe runter, als wären Fußgänger Straßendreck. Fußgänger kratzen sich in der Straßenmitte so konzentriert am Hodensack, dass sie dafür stehenbleiben. Autos haben keine Hoden, müssen nicht ernst genommen werden. Wollte die Straße einen Diktator wählen, gäbe es nur Kandidaten und keine Wähler. Mehr lesen
Ada Ciganlija

Savefahrt

Belgrader Balkon

Schreibmaschine
Ich bin als Mitschreiber aufgeboten bei einer Art Vortrag / Gespräch von Andreas Maier, muss tippen auf einer Schreibmaschine (→ Ivo-Andrić-Museum), fortsetzen etwas, das ich kaum ansatzweise verstehe, von Maier lieblos verkomplizierend erklärt bekommen habe. Weiß ständig irgendwelche Tastenbelegungen nicht. Ein Sinn des Vorgetragenen ergibt sich allenfalls für Momente. Im Publikum sitzt unter anderem S., die sich einigermaßen liiert mit mir fühlt seit einem Kuss. Da ist aber noch mindestens eine Andere. Gefühl: missbraucht und missachtet einem mäßig interessanten Gedankenfortschritt beizuwohnen, dabei ständig bedroht meinerseits als untauglich aufzufliegen (das Unigefühl).
Ewart Reder

Wie ein Film der folgende Traum
Kurz bevor ich in eine WG gezogen wäre
fährt mich eine Lokführerin
irgendwohin andere auch aber
zwischen der und mir funkts so richtig.
Irgendwann fährt sie dann nicht mehr
ich und eine Gruppe anderer
deren Teil ich war oder bin
suchen sich ihren Weg ins Überleben
ein Hotel ist schon voll
morgen hätten sie was und
die Nacht können wir mehr oder weniger
offiziell in einer Art Warteraum verbringen
mit Getränken Beamer und tollen Filmen
wer sagt da nein ehrlich?
Und entweder da passierts
dass die Lokführerin auch überbrücken muss
oder sie bricht aus
oder ich
auf jeden Fall treffen wir uns
unweit ihrer Wohnung wieder
und die ist verrückterweise direkt neben
der WG in die ich fast gezogen wäre
an deren Haus ein total liebes
„WILLKOMMEN“ Schild hängt
das ich abhängen will um Klarheit
zu schaffen und dabei begegne ich
einem total netten Bewohner nach
dem anderen meistens Männer
aber auch eine Frau die es
ohne Weiteres auch hätte werden können
(M.B.?)
die aber mit ganz viel Verständnis
und vielleicht sogar Freude für mich
mitkriegt dass es da anderweitig
gefunkt hat und wie!
Die Lokführerin nimmt mich mit
in ihre Wohnung ist total schmusig lieb
zu mir legt Hand an meine
enorm stramme Latte einfach
weil ich total erschöpft bin und sie
mich nicht unter Druck setzen will.
Irgendwann / irgendwie sitze ich aber
mal mitten in der gemeinsamen Straße
die Lokführerin und ich reden ganz toll
sie versteht 100% von meiner
verschrobenen Art die Dinge zu sehen
und sie oder irgendwer fordert mich auf
das was ich geschrieben habe vorzulesen.
Das lese ich erst in die Richtung WG
da kommt es so mäßig bis gar nicht an
dann lese ich das in Richtung Haus
in dem die Lokführerin wohnt
da ist schon mehr Resonanz aber
wieder ganz hin und weg und dabei ganz
entspannt und natürlich ist die Lokführerin
(irgendwer anders könnte auch noch gelesen
und deutlich mehr Erfolg gehabt haben).
Meine Sachen waren / sind vor allem ehrlich
nicht aufgesetzt nicht angeberisch
riesenhafte Gefühle kommen darin vor
die kindlich aufrichtige Menschen haben
und das scheint hauptsächlich der Lokführerin
sonst aber nicht so vielen zu gefallen
die ihrerseits supernett und begabt sein können
vor allem die WG-Bewohner.
Aber mit der Lokführerin ist es einfach so schön
das findet sie auch und sagt es mir
dass ich überrascht riesig glücklich bin
und das hab ich alles aufgeschrieben
direkt nach dem Aufwachen um halb fünf
noch vor dem Aufs-Klo-Gehen. Immer
das blöde Aufs-Klo-Gehen hab ich
gedacht meinen Stift rausgeholt
meine Kladde und einfach aufgeschrieben.
Ewart Reder
Wien 2024

Jeder Blick trifft mich dort, wo es am meisten schmerzt
Jedes Lächeln ist ein verzerrter Schrei
Jede Handlung ein Schauspiel
Die Worte reißen entzwei oder kommen gar nicht an
Jeder Schritt entfernt
Alles ist nicht genug
Wenn es nicht das Richtige ist
Wir fliegen
Aber ich verrate dir nicht
Dass mein Flug ein Fall ist
Vanessa Verzay
Ein randvoller Eimer voller Erinnerungen
Rollt ins Meer und verliert auf dem Weg seinen Inhalt
Nichts wird aufgehoben, wohl aber vom Wind davongetragen
Die Stille weiß Bescheid, während die Worte nur so tun als ob
Die Wellen kommen und gehen und nehmen mit
Das Wasser verschlingt
Der Sand, er rinnt
Zwischen den Sekunden und Minuten
Vanessa Verzay
Die Ohren hören die Melodie
Das Herz empfängt nicht
Die Augen sehen wohl den Glanz
Die Seele erreicht er nicht
Der Körper nimmt wahr, all die Zartheit
Die Nerven verstecken sich im Steinkleid
Doch sie sind da
Sie ist da
Er ist da
Empfänglich und ergiebig
Trifft nichts auf fruchtbaren Boden
Dem Wachsen entzogen
Das Nähren verboten
Die Wogen
Nicht geglättet
Errettet das Innnere
Es schimmere
Für immer
Im Fluche
Des halben Ganzen
Des nicht ganz so Grünen
Des Lebens im Sterben
Des Todes im Werden
Vanessa Verzay
Was zusammenhält
Was ist Kultur? Die von Herder und Hegel bis Derrida und Eribon oft gestellte, ebenso oft verkomplizierte Frage beantwortet sich einfach: Kultur ist, was Sommerpause macht – minus Politik. Die Wahrheitsdrohne weiß das, ist pünktlich weggeflogen. Was bleibt mir als ihr nachzureisen? Ins 2024 zum dritten Mal in Folge und überhaupt mit Abstand am häufigsten als „lebenswerteste Stadt der Welt“ vom britischen Economist ausgezeichnete Wien geht es. Ich will wissen: Wer oder was macht Wien so lebenswert? Mehr lesen
Ruderboote

Autokorrektur 2021, Nr.20
Da wartet sie vier Wochen auf den Frisörtermin.
Beim Frisör, bittet sie ihn, sich zu beeilen.
Da kann man nur den Kopf – die Frisur - schütteln!
Autokorrektur 2022, Nr.7
ORT
Ja – Ort und.
Dann: da sein.
Sprechen hören.
Sprechpausen
dehnen den Raum -
kaum, aber etwas.
Tutti. Aufgeregtes Sprechen
treibt.
Pausen: geschrumpft.
Molto bene.
Autokorrektur 2023, Nr.28
SECHSMAL
SECHS IST
SECHSUNDDREISSIG
Bin ich immer
noch so fleißig?
Lockt der Tag,
fragt, was ich mag.
Mein Hirn verstopft,
Gefühl verkopft.
Kleines Herz
sucht Scherz und Schmerz.
AUCH DIESMAL
DREHT SICH DIE KATZ
UM IHREN STERZ
Cornelia Kube-Druener
Inner Summer

Der blaue Mond
Eine schwarze Seerose
taucht aus dem Nachtmeer
In der Luft öffnet sich die Blüte
Ein blauer Mond
steigt aus Blättern
lehnt sich an eine Wolkenhand
Schwarze Tropfen gleiten
aus den Fingern
Joachim Durrang
Nachtszenen
Menschen mit schwarzen Steinen auf den Köpfen
laufen durch die Nacht
In einer Schattenecke
krümmt ein Paar
die Beine übereinander
umarmt den fernen
anderen Körper
Im Haus hockt die Katze
beobachtet die Maus
auf dem Bildschirm
Sie singt ein Mäuselied
in das sich der Tanz
eines Tänzers mischt
Joachim Durrang
Liebesdrama
Auf der einen Seite des Meeres
hockt der Prinz
auf der anderen die Bettlerin
Sie können nicht zusammenkommen
Die Bettlerin hat kein Geld
für die Schiffsfahrt
Der Prinz raucht lieber
eine Zigarette
Joachim Durrang
Purple Rubin

Werden diese Zeilen irgendwann
von Zeigefingerspitzen berührt
Während durstige Augen sie sehen
Und ein hungriges Herz sie verspeist
Wird mein Name irgendwann einmal
Einen Buchrücken zieren
Dessen Worte einer Seele
Das gebrochene Rückgrat stärken
Müssen alle starken Geschichten
Durch geschundene Leiber erlebt werden
Müssen alle wahren Worte
Durch zugenähte Münder passieren
Wird jemand jemals von meinem Schmerz profitieren
Profitiere ich letztlich von alldem
Wenn ich mich distanziere
Bleibt dieses Werk für sich bestehen
Wie viele werden es zertrampeln
Für welche Hände ist es Schmierpapier
Wer wird es verschenken ohne Sinn
Bleibt es vielleicht für immer hier?
Einvernehmlich nehmen sie ein,
Einigkeit vergeblich suchend steche ich mir ins Bein
Drei Mal geschrien, viermal den Mund geöffnet, fünfmal überhört
Hat es irgendwen gestört? Vielleicht
Ich entgleite dieser Welt, wie ein Aal aus ihrer Hand, sanft
Falle ich in die Tiefen, erwache in der Nacht schweißgebadet
Ich trauere schon, ihr liebt noch
Ich versuche noch, ES siegt schon
Ich bade in Glitzer, gleite tiefer in die Wärme, aber sie dringt nicht tief genug ein
Vertreibt die Leere nicht, die Kälte nimmt sich allen Raum und die Luft dazwischen
Sie zischen und fischen sich den schlimmsten Fall der Fälle
Im längsten Fall sieht man doch am Ende mehr von allem Hellen
Ich hasse mein Sein
Weil es mir nie reicht
Weil ich mehr sein möchte
Als ich gerade bin
Ich werde nie erfüllen
Was ich von mir erwarte
Und es ermüdet mich
Gegen mich selbst zu kämpfen
Vanessa Verzay
Seeburg Biebrich

Das Nationale
frei nach Rilke
Das Nationale ist nichts
Als des Lachhaften Anfang, bei dem wir gerade noch ernst sind,
Und wir verachten es so, weil es lauthals versagt
Uns zu erheitern.
Ewart Reder
Rotkäppchen und der braune Wolf
Denke ich an die neueren, längst nicht mehr neuen Wahlergebnisse in Europa, packt mich das Grauen. Rechts außen braucht es keine Argumente, kein bürgerliches Mäntelchen und nicht mal den Mindestleumund der Gesetzestreue mehr – die werden immer gewählt. Der Gedanke beschleicht mich, die bürgerliche Mitte könnte schon so schwach sein, dass ich ihr etwas Gutes tun muss. Sie wählen zum Beispiel. Um das noch Schlimmere zu verhindern. Von der Weimarer Republik erzählt man sich, sie sei untergegangen, weil die Mittelparteien nicht mehr gewählt wurden. Daran ist ein Haken, den ich in einer Koproduktion mit den Gebrüdern Grimm zu bezeichnen hoffe. Mehr lesen
Schloss Hoechst

Burg Falkenstein I
Für Rainer Hock
[7. Teil der Prosareihe „Türme“]
Die Kühle des Waldes, in der man sich erhitzt, bergan. Luft wie leichtes Schwitzen um den Hals. Was läßt sich formulieren? (auch: Welche Worte kommen zu Luft und Wind hinzu?)
Ein Preßlufthammer brechte unter die Waldöffnung. Der Burghain ging steil hinein in den blätterüberrundeten Weg. Die Bäume stehen dichter und lassen bald nur noch den Eingang offen, an dem mein Aufstieg begann. Erst allmählich höre ich das Diskrete meiner Schritte wieder, verbunden durch das Knirschen zwischen dem feuchtweichen Laub, das erst nächst dem Boden ein zerfließendes Geräusch machen wird. Was läßt sich formulieren? und was muß, oder soll, formlos bleiben?
Koch ist das Licht grün. (Was sage ich da?) Hinter dem Blattwerk taucht die Pallisade auf; die Sonne verschwindet auf Etappen hinter der Silhouette des Turms und ich erkenne daran den Absatz in seiner Gestalt. (Ich wußte es, von einer Fotografie. Und noch vor seiner Auferstehung steht der Turm nicht mehr einzeln da.) Es wird etwas dunkler; noch immer steil steige ich von unten durch das Torhaus. Der lange Halblichttag, halb Vormittag im Schatten des Burgtors und halb im schattigen Walddach der Nachmittage des Wärters, endet abrupt.
Aus dem Morgenwald herauf trete ich in den Burghof. Von seinem Plateau stürzt der Eingang ab, ihm gegenüber liegen Wälle vor dem Tal und unterstreichen die Aussicht. Nach der Dunkelheit zeigt sie auch hier zuerst einen anderen Turm. Auch er steht mit einer Stufung. Entlang einer Spitze macht das Dach dort den alten Verweis der Türme: Er geht in der Entfernung verloren und mein Blick rutscht ab in ein Castell unter seinem nach. (Links von mir stehen erhöht Bäume und schauen noch weiter herab.)
Erst danach sehe ich den hiesigen Turm. Vom diesigen Licht kaum unterschieden, ganz kanonisch nach links in die Ecke des Hofes gestellt. Kanonisch. Dieser Turm ist kanonisch.
*
Und fast ist es passiert. Längs der beinhohen Mauer, die ich erreiche, herrscht das Plateau. Der Turm also liegt hier in meinem Rücken und ich folge der Ausdehnung der Ebene. Die kleine Inklination, mit der sie meine Bestrebung bezwingt, zeigt mir den nächsten Bergrücken am Rande der Diesigkeit verlaufen. Die gerade Mauer an meinem Schenkel ist ihm gegenüber gezogen, (Oder bezeichnet sie nur eine der vielen Rippenenden, welche diesen Rücken bilden?) über die Brüstung gelehnt siedelt sich von unten schütterer Wald herauf (wie fieberschwaches Rippenfell; seine Farbe deutet auf eine Genesung. Es beansprucht nicht viel; etwas Licht, etwas Luft. Edle Tannen sind einzeln.) auch die Villen sind dünn verteilt, und dazwischen ein unwilliger Strom im Geäder der Landstraßen. Wie die Bäume buschig über die Pallisade ragen, nehmen sie all das nach unten zurück. Überhaupt ist die Ruine in Filterung gelagert. Jeder Zuweg ist in den Wald versteckt und der Blick muß straucheln an den Bäumen. Geräusche unter dem Abhang bleiben liegen wie in einer Bucht, sie Sonne versickert durch den Dunst halb über den Wald. Verdünnung bis in das milchige Licht dieses Morgens.
Und also fragt der Ausblick nach der Sicht anderer Tageszeiten. D.h. nach den Höhen der Sonne. Also zurück: Wie betrifft die wechselnde Höhe den Turm?
Vom Burghof aus ist es einfach: Über dem Platz geht der Turm in seine Höhe, um der Flagge ihre Fahrt darüber hin zu halten. Es ist sehr spannend. So sehr hat die Flagge ihre Richtung (im Mitte1 der Ausweichbewegungen, die sie um die Luftwirbel herum aufhalten), daß sie den Turm fast mitreißt. Er hält seine Fenster dagegen in den Platz; müßte die Panne nicht lavieren, er brauchte noch die Befestigungsmauer, um gegen ihre Geschwindigkeit nicht vom Plan gezogen zu werden. – Und fast wäre es passiert.
Was sollte denn passiert sein? – Ich vermute den Muskel im Nacken, der schmerzt, und will seine Bezeichnung nachschlagen, der meinen Blick richtet bis in den Angriffspunkt der Fahne; ich will ihn in jede Höhe halten, Disziplin, auch wenn meine Beinmuskeln nach den Treppen verlangen (die nichts sehen). Ich gehe ein Stück; bis der Turm im Abstand von der Ostseite einen Ansturm nimmt.
Von der Grasnabe aus, über ihre steinig ansteigende Erhebung, auf den blanken Felsen schießt mein Blick steil am Fundament vor-bei, in die Skischanze der Wand, kommt über ihre grad anstehende Fläche, zur Ummauerung empor, wo er aufgeht und im Rundturm oben landet. – Mein Nacken hält es eine Weile aus. Dann spüre ich, wie die Wand unter meinen Augen aus dem Flackern der Fahne sich sammelt, mein Blick rutscht langsam ab, nach unten, die Fläche ist wieder offen, das Fenster hat keinen Halt, weil die Wand vor mir zum Boden reißt, mit Wucht zum Felsen wird, der auf mich zuläuft, Flecken erhält von Gras, zur Wiese wird, zum Grund, und auf dem Weg vor mir verebbt. – Die Augen bleiben. Kurz. – Wieder wissen sie den Turm, sind bei der Graserhebung, auf dem Felsen, der sich pellt, zum Fels, zum Fundament aus Steinschicht wird, Schichtung, Wandung, Wand, deren Fenster aufhält, ausläuft, endlich festhält – und nach kurzem wieder abfällt. Ein idiotisches Neigen und Nicken. – Ich breche ab.
Vor der Wand des Turmes zeigt mir dieser Vorgang: Er steht nicht gegenüber. Gegenüber ist hier – noch einmal! – die Landschaft; der Ausdruck ihrer Parallelität vor den Wällen: sie liegt. Ich orientiere mich geographisch.
Ich folge den festgetrampelten Wegen zwischen den Halten und Stufen. Von nahe an der Nordbefestigung ist der Turn ein Keil, die versetzten Fenster der zwei Flanken unterscheiden ihn vom Kiel. Selbst in den ohne Wolken stehenden Himmel ist er schnittig. Nach halber Höhe beschleunigt ihn die abgebrochne Mauer aus der Ecke heraus, an ihrem unteren Ende wird er langsam; schließlich steht er, auf von Wiesen überwellten Klippen. – Ich steige selbst.
Die gerundete Treppe aus dem Osten in den Süden des Aufgangs herumkommend, finde ich das bespitzte Törchen geschlossen. Ich schaue nach links in den Gegensöller vor der Pallisade. Aus seiner schweren Rundung hebe ich den Kopf über die Stufen bis zum Eingang, neige ihn weiter an dem Turm entlang zum Fenster, steiler empor, und lege ihn weit zurück.
Der Turm von unten leistet der Fahne keinen Widerstand mehr: Er hat sie verschluckt.
(Unter dem romanisch runden Bogen in der Mauer bleibt nachzutragen, daß die Tür nur angelehnt war. Ich zog sie aus ihrem Rahmen aus dem rötlichen Sandstein, so daß sie nun wieder eisern auf ihren Steinzargen schlägt.) Meine Beine lösen den Kopf-Hebe-Muskel ab, mein Blick ruht.
*
Dieser Turm überlistet. Er ist kein luftiges Schneckengehäuse, keine Spirale ist ihm ein-gezimmert. Der Turm selbst hat etwas freigelassen, das unter meinem Schritt die Stufen ergibt. Der Turm ist massiv. Nichts anderes ist er, als was er von außen scheint: Steinaufftürmung. (Einzig ein wenig fremd an ihr, in seine Aufrichtung hinein, ist ein gewundenes Loch.)
Da meine Gedanken eine Höhlung hervorbringen wollen, muß ich dem Turm nachgehen. Er wurde abgelegt; Schicht um Schicht. Darin je eine Lücke, die sich mit jener zu-setzlich aufgetragenen Brockenlage verschob. Ganz unten auf der Erdschicht war das Aussparung, sie fraß sich zur Mitte der nächsten Lagen.
Die darauf die Anordnung der Steine besorgten, bestimmten den Verlauf des Einschnitts –(zunächst in einen allmählichen Winkel in den Westen herum).
Die von unten die Findlinge anreichten, konnten das dagegen verfolgen, wenn sie in die seitliche Spalte ihrer Erhebung schauten. Darüber hinweg nach oben zu sehen, wurde nun möglich. – Und es passierte etwas Eigenartiges.
Mit der vollständigen Belegung der über Kopf hohen Schicht, die nun also von oben ein Loch ganz umschloß, ging auch vor den Augen der Unteren die Spalte in der Erhöhung nach oben zu. Gleichzeitig entstanden zwei um-mauerte Öffnungen! – Genauer:
Wer bis dahin von unten nach oben gestiegen war, hatte sich für kurz zwischen zwei Wänden bewegt.
Nun verschwand man in einem stehenden Loch; aus einem liegenden tauchte man wieder oben auf. – Warum beide Löcher gemeinsam vollendet sein mußten, gleichzeitig, konnte man erleben: Verschluckt-werden.
Und das Verschwinden konnte nun ruckweise länger gemacht werden. Wer unten in die Mauer trat, kam immer später wieder zum Vorschein: je höher die Schichtung wurde. (Hiermit begannen die beiden Löcher, trotz ihres gemeinsamen Ursprungs, einander zu unterscheiden: Das untere aufrechte blieb fest, wie es fertiggemauert worden war. Oben wanderte das Loch in seinem steinernen Horizont langsam herum.) Weiter: Wer durch es emporlugte, wurde inzwischen von einem anderen Himmel überkommen. Längst ist, wer empor steigt, vom Himmel der Luft getrennt.
Er ist im Stein.
Es mag eine Länge dieses Durch-Stieges geben, nach der sich der oberste Himmel am Erlebnis ImStein klärt. Ihr entspricht eine Höhe der Schichtung. Dieser eine Lage des horizontalen Loches auf der künstlichen Erdverlängerung. (Hat einer seine Wanderung innerhalb dieses Horizontes erfaßt?) Daß dies Loch nun mit weiteren Schichten Stein weiter wandern kann, ist belanglos. Daß es sich nicht wieder öffnen soll, indem es den Rand der Schichten berührt und zur Ausbuchtung weit wird, geht aus seinem Begriff hervor: Loch öffnet sich nur einfach! (Hatte einer bedacht, was passierte, wenn das Loch die Steinkante einige Schichten hoch doch wieder berühren würde?)
Ich schaue durch das hocheckige Fenster. Unten liegt, ein Bassin von hier aus gesehen, der doppelte östliche Verlauf der Ummauerung. (Die Orientierung des Hinausschauens erscheint mir fremd.) Unter dem romanisch runden Fensterbogen der Nordseite kann ich aufrecht stehen. (Ist die Nordfassade von innen Südwand? – Muß ich immer meinen Blickpunkt angeben?) – Das Loch ist hier aufgegangen nach zwei Seiten und trennt in der halben erstiegenen Höhe die Steinschichten in zwei Teile. Zwischen ihnen schaue ich aus, hinunter vor die Wälle. Wer hier in der Öffnung zur Wache stand, hatte zu fürchten: (In den Himmel gab es die wenigste rettende Flucht.) Ich vergesse Charakter und Zeit dieses Turmbaus nicht.
*
Ein Mann verschlösse den Ausgang auf die quadratische Umkröpfung des Turmes. – In einer zweiten Überlistung führte der Turm in einer Wendel über die Fenster hinaus, (dies kann Beton!) um mich nun doch in einem schmalen stehenden Loch an der Seitenwand zu entlassen. Über meinem Kopf erhebt sich ein aufgesetzter Würfel, geschmälert gegenüber dem Quadrat der Turmmauer um den Rundgang der Umzargung, in die ich hinausgetreten bin. Auf dem Würfel, zuoberst, der Zylinder des Rundturms. Er ließe von oben die Würfelecken überstehen; in den vier Seitenmitten steht er selbst über, ein großer Bottich. Die Flagge reicht wieder in den Blick, wenn ich im Westen hinter der Sonne stehe. Unten mischt sich ihr Schatten in die Unruhe der Baumkronen, die den nächsten Rücken des Burghains formen.
Schaue ich hier unter das Überlappen des steinernen Passes und weiter zur Plagge hinauf, gehe ich gerade. Mein Blick haftet an der Mauer. Sie wird erst unsicher, wenn er nach oben geht und die Sonne wieder neben mir ist: eine Ablenkung zur anderen offenen Seite. Sie bekommt Übergewicht; schlimm im Moment, da mich die Kante der Seitenwechsel zur um-laufenden Mauerung stößt. – Ein Fussel meines roten Pullovers fliegt in den Wind. (Senkrecht erkenne ich das gelbe Wärterhäuschen in seinem Dunkel nicht mehr, aufrecht leckt und lappt die Fahne.) Gerne möchte ich mich an etwas halten.
*
Die Flagge ist zurückgekehrt zur Fahne, dreigestreift, und zerfranselt am Ende. Sie opfert sich ihrer Beweglichkeit. Sie überläßt sich dem Sturm, folgt dem Wind, läßt sich bewegen von der dünnsten Luft. Bis in die Bindung von Kette und Schuß gibt sie sich hin, Faden um Faden; bis sie verschossen ist und zerschlissen am Mast kleben wird im Regen.
Die Fahne: Ihre Beweglichkeit opfert sie. – Nicht so der Turm.
(Sein Aufgang in den aufgesetzten Bottich ist verschlossen. Soll ich das Gitter übersteigen auf die hölzern fortgesetzte Stiege zur Verankerung der Fahne? – Eine weitere Umrundung unter ihr vorab:) In der ausgebreitet flachen Sonne lernen meine Augen die Mosaike der Würfelmauer. Und zwei Steinfarben aus ihrem Bestand sondere ich: Türkises Meer-Grün. Und bläulich helles Abendrot-Violett. (Das ist genug.) Fett und sogar ein wenig glänzend eine Schlangenader in einem der größeren Blöcke. Sie macht die langsamste Bewegung: (im Regen, nicht in der Strömung der Luft.) Sie lassen sich, Splitter auf Splitter, gelassen, Korn um Korn, auswaschen, herabtragen im Guß, Kristall nach Kristall, ablagern irgendwo entlang der versickernden Rinnsale, die trocknen über die Mauer herab, und Stäubchen über Stäubchen weht (endlich noch) in der Boe vor der nächsten Gewitterwolke weg. – Die langsame Fahne des Steins.
Was trug der Süden dieser Bewegungsform bei, mit welcher Gefahr vermehrte der Süden ausgerechnet diese Vergänglichkeit, daß dort die obersten Steinplatten der Umfriedung wie Geschütze hinausgerichtet sind? Waagrecht nebeneinander, bilden sie eine Batterie, die sich selbst verschießen will, auf ein Mal und am Stück.
Sonst sind die Platten und Quader nach Vermögen miteinander vermörtelt. Nur zum Feldberg hin (jeder Karte eingezeichnet, jede Wanderung soll Notiz von ihm nehmen) sind sie noch einmal gleichmäßig nach außen geordnet: Wie ruhende Akten, zwischen sandigen Deckeln im Hängeschubfach abgelegt. – Ich finde einen kleinen flachen Stein, leicht nach einer Seite gewellt. (Beschreibe ich ihn, den Moment seiner Formgebung recht? Jemand muß Kaffee über diesen Schnipsel verschüttet haben.) Schiefrig blättert sich seine Schichtung auf: Soll ich ihm die Reise nach unten geben? – Ich gebe sie. Er kommt nicht so weit, trotz Schwung, wie ich aus der Höhe (in die Ferne) dachte. (Um die ersten Häuser hätte ich gefürchtet, oder um ein Autodach.) Dumpf fällt er ins Gras am Felsenfuß des Turmes. Ich entschließe mich also: Noch höher. (Ich gelange aber nicht über die zu hohe Eisenverzahnung des Gitters im Innern.)
Axel Dielmann
Uferböschung

Paragraphenblüte
Die Wahrheitsdrohne überfliegt Deutschland und sendet historische Bilder: blühende Landschaften, soweit das Kameraauge reicht. Osten und Westen bedeckt von sattem Grün. Doch was wächst da, was blüht? Kohl scheint es nicht zu sein. Die Drohne zoomt sich ran und wechselt in den Tiefflug, um Rauchschwaden zu durchdringen, die von Deutschland aufsteigen. Letzter Zweifel verfliegt: Es ist Cannabis. Weiterlesen
Das Leben hat schon angefangen
literaTurm 2024 fragt nach der Schönheit
Frankfurts Literaturbiennale heißt literaTurm, weil Lesungen und Diskussionen in den Topetagen der Bankentürme stattfinden. Fremdheit ist also ein Grundmodus, in dem die Literatur sich da erlebt. Mit dem diesjährigen Motto hatte die gewitzte Kuratorin Sonja Vandenrath der Literatur einen zusätzlichen Schuss Fremdsein ins Badewasser gegeben: „On Beauty“ steht auf den Plakaten, die Frauenbeine beim Baden zeigen. Die davon geweckten Assoziationen dürften weitgehend ohne Literatur auskommen, was die Entfremdung andeutet. Kommt umgekehrt die Literatur heute weitgehend ohne Schönheit aus?
Zur Eröffnung setzte Vandenrath in ihrer Keynote eins drauf, verwies auf die Kosmetik- und Bodycareschlachten in social media und meinte, „dass die Künste sich vor einem entfesselten Schönheitswahn regelrecht retten müssen.“ Die Frage sei, wohin. Auf dem Podium der Eröffnungsveranstaltung führte die Ästhetikprofessorin Juliane Rebentisch aus, wie bereits seit dem 18. Jahrhundert gelte, dass Schönheit nicht nur ihren Gegensatz braucht, das Hässliche, sondern zusätzlich eine un-schöne Ergänzung, um Übermäßiges und damit Ekelerregendes zu vermeiden. Der Dichter Durs Grünbein nannte Schönheit bezogen auf die Gegenwartsliteratur einen „prekären Begriff“, für die meisten Künstler sei das „keine zentrale Kategorie mehr“. Bestätigt wurde er durch die Jüngste der Runde, Dana von Suffrin, die sich zum Thema kaum, ausführlich hingegen zu ihrem neuen Roman Nochmal von vorne äußern wollte. Nur dem Geschick von hr-Moderator Alf Mentzer gelang es, ihr zwei Statements zur Schönheit zu entlocken. Es gebe „schöne Momente“ in dem Roman. Und die Vaterfigur, ein Holocaustüberlebender, sei aufgrund seiner Erlebnisse nicht mehr empfänglich für Schönes. Die lapidare Feststellung wurde nicht diskutiert. Denkt man an Herta Müllers Atemschaukel, könnte man ihrer Verallgemeinerung widersprechen. Das Battisttaschentuch der Großmutter, einziger schöner Gegenstand in Reichweite des Icherzählers, wird da zum Überlebensgrund, zum Freund. „Ich schäme mich nicht, wenn ich sage, das Taschentuch war der einzige Mensch, der sich im Lager um mich kümmerte.“
Diskutiert wurde an dem Abend überhaupt nicht. Trotz unermüdlicher und raffinierter Bemühungen des Moderators, Gesprächsfäden miteinander zu verbinden, zogen die Gäste es vor, ihr jeweils eigenes Garn zu spinnen, zentimeterweise und unzusammenhängend. Der interessanten Schnipsel gab es genug. Grünbein sprach unter anderem vom Hässlich-Bedeutenden im Expressionismus, von der Elegie als dem schönen Betrauern von Verlorenem sowie – mit Bezug auf seinen aktuellen Roman Der Komet – von der Schönheit Dresdens als einer Behauptung, die immer vor der Anschauung, vor der überprüfenden Besichtigung stehe, bei ihm seit seiner Dresdener Kindheit. Rebentisch spitzte zu: „Kunst ist immer da, wo die gerade geltenden Normen von ihr nicht sind.“ Und Suffrin erzählte, wie ihr als studentischer Fremdenführerin durch die Münchener Residenz eine Hauptschulklasse zu allen Objekten nur die immergleiche Frage stellte: „Wie viel kostet das?“ Was ihr damals nicht gelang, scheint sie mittlerweile nicht mehr zu intendieren. Keine Schönheit nirgendwo. So wenig Interesse an ihr, dass kein Gespräch entsteht, was diejenigen Besucherinnen der Veranstaltung, mit denen ich sprach, doch eher unzufrieden hinterließ.

Ganz anders lief die erste Einzelveranstaltung, ein Panel unter der Überschrift „Gegen-Schönheit“. Hier tauschten die Rednerinnen sich lebhaft aus, die Moderatorin (Cécile Schortmann) reüssierte und das Publikum hatte Teil an einem Erkenntnisgewinn. Es ging jetzt explizit um Hässlichkeit“, wie Moshtari Hilal ihr neues Buch genannt hat. Die „Schönheit“, mir der sie sich auseinandersetzt, ist der von Sonja Vandenrath angesprochene Wahn, alle Menschen sollten so aussehen, wie ein kommerziell induziertes Ideal es will. Während Hilal bei der Zwangserfahrung ansetzt, die sie als Pubertierende mit dem Ideal machte, geht ihre Gesprächspartnerin Elisabeth Lechner in ihrem Buch Riot, don’t diet den umgekehrten Weg. Sie beginnt mit der Analyse des Gesellschaftsverhältnisses, auf die Hilals Überlegungen hinauslaufen. Erst während sie ihr Buch schrieb, merkte Lechner, wie stark der Normdruck sie auch persönlich betraf. Dass Frauen ihm besonders ausgesetzt sind, zeigten die Autorinnen scharfsichtig. Diät, Depilation, Kosmetik, Schönheitsoperationen und vieles mehr werden als „Schönheitsarbeit“ (Lechner) verrichtet, die mit gesellschaftlicher Teilhabe entlohnt wird – oft auch nur ein leeres Versprechen. Schönheit so verstanden hat jeden Zauber verloren und das Plädoyer der Autorinnen, dass wir statt uns zu optimieren besser unsere Körper feiern und Vielfalt, nicht Monotonie, genießen sollten, kriegt mich – mit einer Einschränkung (die nicht diskutiert wurde). Dem Vergleich als solchem entkommen wir nicht. Ihn abzuschaffen oder zu unterdrücken macht unehrlich und unlebendig. Herausragende Talente im Sport wie in der Kunst werden bewundert. Sie animieren andere dazu, besser zu werden. Ihnen zu unterliegen ist kein Scheitern, sondern Selbst-Bestimmung mit der Chance sich zu finden. Nimmt man Schönheit vereinfachend für Attraktivität, wird auch sie die Menschen immer unterscheiden – nicht objektiv oder kategorisch, sondern dem Erfolg nach. Wer das diskreditieren oder wegdiskutieren will, endet als der Antiheld Schumacher in Jean Renoirs Die Spielregel: ein Spielverderber, über den die Verlierer herzlicher lachen als die Sieger.
Was Schönheit ist, wer sie definiert und wie ihre Definitionen einander abgelöst haben, darüber diskutierten die Philosophen Omri Boehm und Joseph Vogl. Nicht nur, weil Immanuel Kant kürzlich dreihundert wurde, sondern weil Boehm bekennender Kantianer ist, saß der Königsberger virtuell mit am Tisch. Seine These, dass Schönheit keine Eigenschaft des Objekts sei, sondern ein Ergebnis des Nachdenkens über dasselbe, klingt modern wie auch der Zusatz, das Nachdenken müsse gemeinschaftlich erfolgen. Was schön sei, bestimme zuletzt ein „Gemeinsinn“.
Während Vogl die Bedeutung des Schönheitsbegriffs für Kant relativieren wollte, sah Boehm in ihm die entscheidende Klammer in Kants Denken. Dass die Vernunft Illusionen wie das „Ich“ benötige, um zu funktionieren, sei ein Defekt. Überwunden werde dieser mittels Kritik, nach deren Einsatz die Vernunftschlüsse allgemeine Geltung beanspruchen dürften – Radikaler Universalismus heißt Boehms wichtigstes Buch. Praktisch erreicht werde ein Konsens oder „Gemeinsinn“ jedoch besser dort, wo Menschen sich in Geschmacksfragen freiwillig einigen, sodass Schönheit zum „wichtigen Vehikel der Aufklärung“ werden könne. Vogl dagegen bezweifelte, dass bei zunehmendem Naturwissen die Vernunft und die Schönheit sich halten werden. Natur sei chaotisch und der Mensch als Teil der Natur begehe mit seinem Vernunftbegriff eine Selbsttäuschung. Vogls Schwanengesang als Philosophieprofessor an der Berliner Humboldt-Universität, eine Vorlesung mit dem Titel „Schweben“, hatte untersucht, wie das Denken nach 1800 fasziniert wurde von Phänomenen großer Unbestimmtheit – etwa Magnetismus, Elektrizität oder Wolken – und sich ihnen gegenüber eine methodische Freiheit, ein „Schweben“ verordnete. Darin komme es eben Kants Forderung nach freier Betätigung der „Erkenntniskräfte“ nach, antwortete Boehm. So unbestimmt, so wenig „Objekt“ wie eine Wolke sei im Übrigen auch der Mensch. Über die Brücke zu einer chaotischen und „blinden“ Natur, die es vorurteilsfrei zu betrachten gelte, wollte Boehm trotzdem nicht gehen. Dem stehe die Würde des Menschen entgegen, die aus seiner Freiheit resultiere.

Andere Gedankenbrücken könnte es geben, wie den Ansatz des Meeresbiologen und Philosophen Andreas Weber, der sich auf den Begriff des Lebens konzentriert. In die Sackgasse der Naturzerstörung sei die Wissenschaft geraten, sagt Weber, indem sie die unbelebte Natur zum alleinigen Maßstab gesetzt habe. Auf dem gleichen Weg sei die Schönheit aus dem Blickfeld geraten und verloren gegangen. Unter Berufung auf den materialistischen Zoologen Ernst Haeckel schlägt Weber vor, Schönheit als dasjenige zu definieren, was uns dem Leben näher bringt. „Nur die Erfahrung des Schönen lotet das Volumen möglicher Erfahrungen aus – ohne Worte, aber doch auf eigene Art höchst rational: Die Vernunft des Schönen nämlich entspringt den organischen Gesetzen, denen das menschliche Leben ebenso unterliegt wie das der Tiere und Pflanzen.“ Zur Veranschaulichung zitiert Weber aus einem Brief Lou Andreas-Salomés: „Man kann doch die Blättchen und Blütenköpfchen nicht sehen, ohne zu wissen: Man ist ihnen verwandt. Der Frühling sagt es so laut, dass auch wir Frühlinge sind. Denn dies ist der Grund unseres Entzückens an ihm.“ (Der Spiegel 29/2008) Aber das nur am Rande eines Gesprächs, in dem – nicht zuletzt durch die Moderation Peter Neumanns, Redakteur bei der Zeit – der doppelsinnige Veranstaltungstitel für alle erfahrbar wurde: „Die Schönheit der Vernunft“.
Und die Literatur? Die braucht und gebraucht ihre Schönheit, um zu tun, was sie kann. Ob sie beim Schreiben die Absicht hätten, etwas Schönes zu schaffen, fragt FR-Redakteurin Judith von Sternburg zwei der wichtigsten Stimmen der deutschen Gegenwartsliteratur. „Schönheit“ als Begriff sei ihr nicht klar genug, antwortet Szusza Bánk. Was sie schreibend erzeugen wolle, seien Eleganz, ein Rhythmus, Musikalität. Dass die Sätze Bestand hätten, auch wiedergelesen nach vielen Jahren. Marica Bodrožić stimmt zu und meint, dann sei „auch die so genannte Wirklichkeit da in der Sprache, der Schmerz, die Erhabenheit“. Ihr ist beim Schreiben wichtig, „dass ich etwas betrete, was ich noch nicht kenne“. Erst wenn „die Sicherheit, die Siegesgewissheit“ weg seien, fange sie an zu schreiben. Schwer sei er und scheinbar endlos, der Weg zu Sätzen, die stehenbleiben, da sind beide sich einig. Bánk denkt nach jedem Roman, sie wolle nie wieder einen schreiben. Und macht doch weiter. Das Glück des Vollendens, des Einverstandenseins nach der quälenden Zweifelsarbeit sei einfach zu groß. „Natürlichkeit ist das Schwerste“, sagt Bodrožić, „im Leben wie im Schreiben. Wenn wir uns beobachten bei dem, was wir tun, kommen wir ab von ihr.“ Und auch sie wird weiterschreiben. „Es ist das einzige, was ich kann.“ Auch sie spricht vom „tiefen Glück“ eines Buchs, seinem „Zustandekommen so, wie ich es will“.

Leseproben der Autorinnen führen vor, wie mächtig „Schönes Schreiben“ (der Veranstaltungstitel) sein kann. Bánks Roman Schlafen werden wir später feiert die Freundschaft zweier Frauen. Figuren zu erschaffen sei Schwerarbeit und Genuss zugleich, kommentiert die Autorin, sie sei gewissermaßen auseinander geflossen in die zwei sehr unterschiedlichen Stimmen ihres Briefromans. Bodrožić liest aus ihrem Essay Mystische Fauna, erzählt Begegnungen mit Tieren, das Mitleiden unter der Gewalt, die ihnen angetan wird. Was sie dabei erlebt, „zeigt über den Umweg der Verletzlichkeit eine Schönheit, die im Kontrast steht zu den äußeren Entfremdungen der von Gewalt, vom Kapital, von Ideologien und Kriegen geprägten Welt. Während alle möglichen Kämpfe in der Welt ausgetragen werden, leben die Tiere ihr Leben, die im Menschen sich selbst sehen.“ Grausame Neigungen haben Mensch und Tier, aber die gegenseitige Zuneigung ist frei davon und Botin einer besseren Welt.
Schönheit ist insofern politisch. „Her mit dem schönen Leben!“ skandierten die Wiener Opernballproteste. Marica Bodrožić macht uns darauf aufmerksam, dass dieses Leben schon angefangen hat. Wir sollten es nicht verpassen.
Ewart Reder
Mai

Salomo

Denkmal für deinen Körper
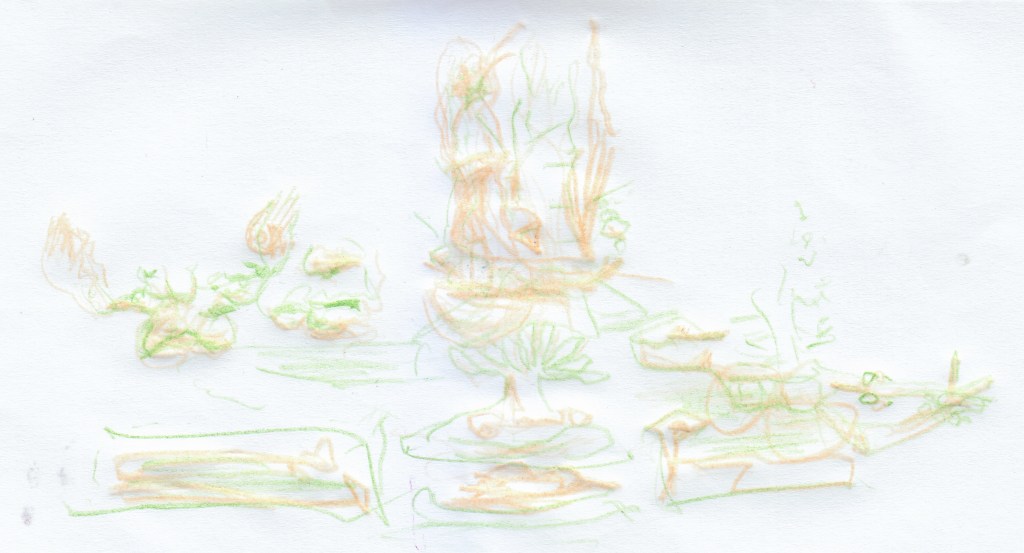
Zugetextet
Meine Frau meint, ich würde sie zutexten. Und nicht nur sie. Auch andere hätten das schon gesagt. „So? Wer denn?“ will ich wissen und zwar zu recht, weil meine Frau sonst Dinge behaupten kann, die mich schlecht aussehen lassen, aber nicht stimmen. Erst will sie keinen nennen, was für mich heißt: Sie weiß keinen, was wiederum bedeutet: Stimmt nicht.
An sich kann es auch nicht stimmen, wie meine Leser:innen bestätigen werden, die sich von mir informiert, angeregt, bereichert, vielleicht auch geistig herausgefordert, konfrontiert, hinterfragt und was weiß ich noch alles fühlen mögen, aber nicht zugetextet. Sonst hätten sie mir das ja geschrieben … Weiterlesen
Buchmessdiener missbraucht!
Die Frau meines Verlegers ist lustig. Verdächtigt mich, ich wolle nur ihren Schnaps, wenn ich mich vor den Verlagsstand in den Gang stelle und Bücher feilbiete: „Pro verkauftes Buch ein Stamperl, aber erst, wenn ich das Geld hab.“ Wer denkt denn an sowas, wenn es um Literatur geht, und noch nicht mal um schlechte?
Und noch nicht mal mein Buch preise ich an, sondern „Smartphone Storys“, die der geschätzte Kollege Gruner herausgegeben hat. Es geht so einfach: „Sie haben doch ein Smartphone“, lautet mein erster Satz … Weiterlesen
Idyll
Aus dem Schornstein
quillt eine Wolke
setzt einen Sonnenhut
aufs Haar
pfeift ein Lied
die Amsel bewegt Beine und Flügel
durch eine Feder streicht
ein Lichtstrahl
Joachim Durrang
Trommel
Kaffee senkt sich in mein Blut
Aus dem Pulsschlag
lausche ich dem Schlag der Trommel
Die Pausen zwischen den Tönen
sind wundersame Momente
da vergeht Zeit
spaziert über die Oberfläche
des Leinentuchs
Joachim Durrang
Die Nachahmung
Erst war der Vogelgesang
da ahmte Adam
Zwitschertöne nach
in die sich Gedanken mischten
zum Tanz von Tönen
entfaltete sich der Sinn
Joachim Durrang
Fingerkuppen
Finger krabbeln über das Leinentuch
Einer erhebt sich
streckt die Fühler aus
wittert Luft
durch die der Atem
einer Zigarette streicht
Fingerkuppen spielen stille Klänge
im Tanz von Tieren
reißen die sprachlosen
Mäuler auf
Joachim Durrang
Endlich in einer Beziehung: Schweden
Heute kreist die Wahrheitsdrohne über Schweden, dem jüngsten NATO-Mitgliedsland. Alles ist anders, zweihundertzehn Jahre Neutralität sind beendet, demnächst vielleicht zweihundertzehn Jahre Frieden.
Auf jeden Fall die Pressefreiheit. Ein neues Gesetz stellt alles unter Strafe, was als Unterstützung des Terrorismus gelten kann. Bei der Definition hilft der neue Partner Türkei … Weiterlesen
Du bist da: Der Stern ist voll

Pleasure’s Greenhouse
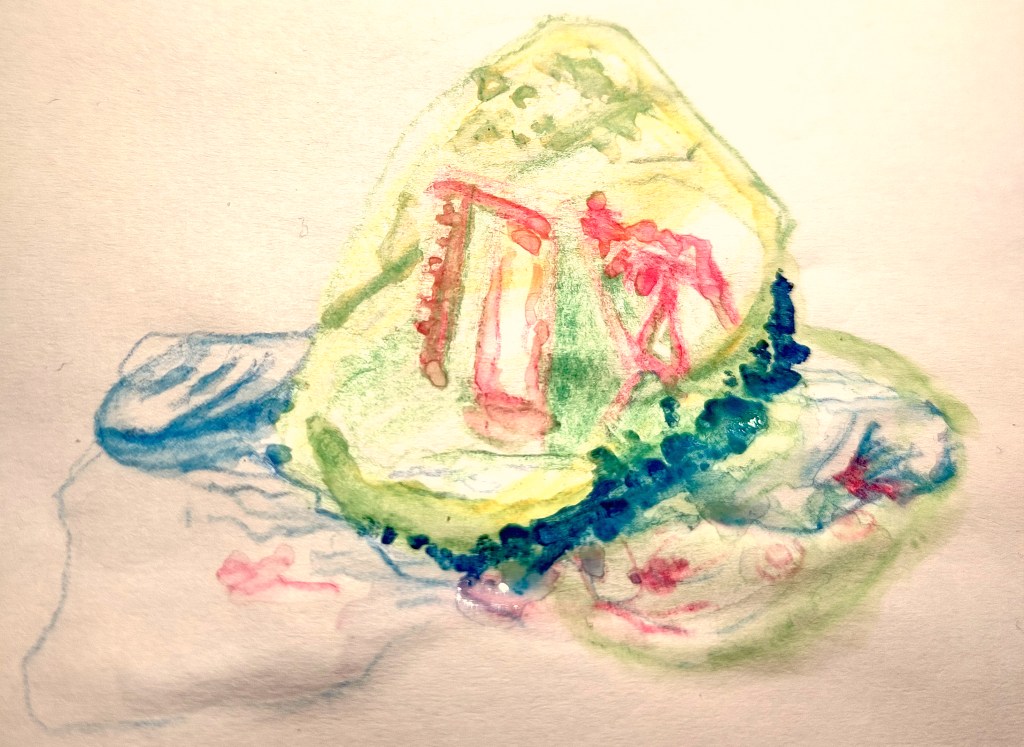
Überall Segen
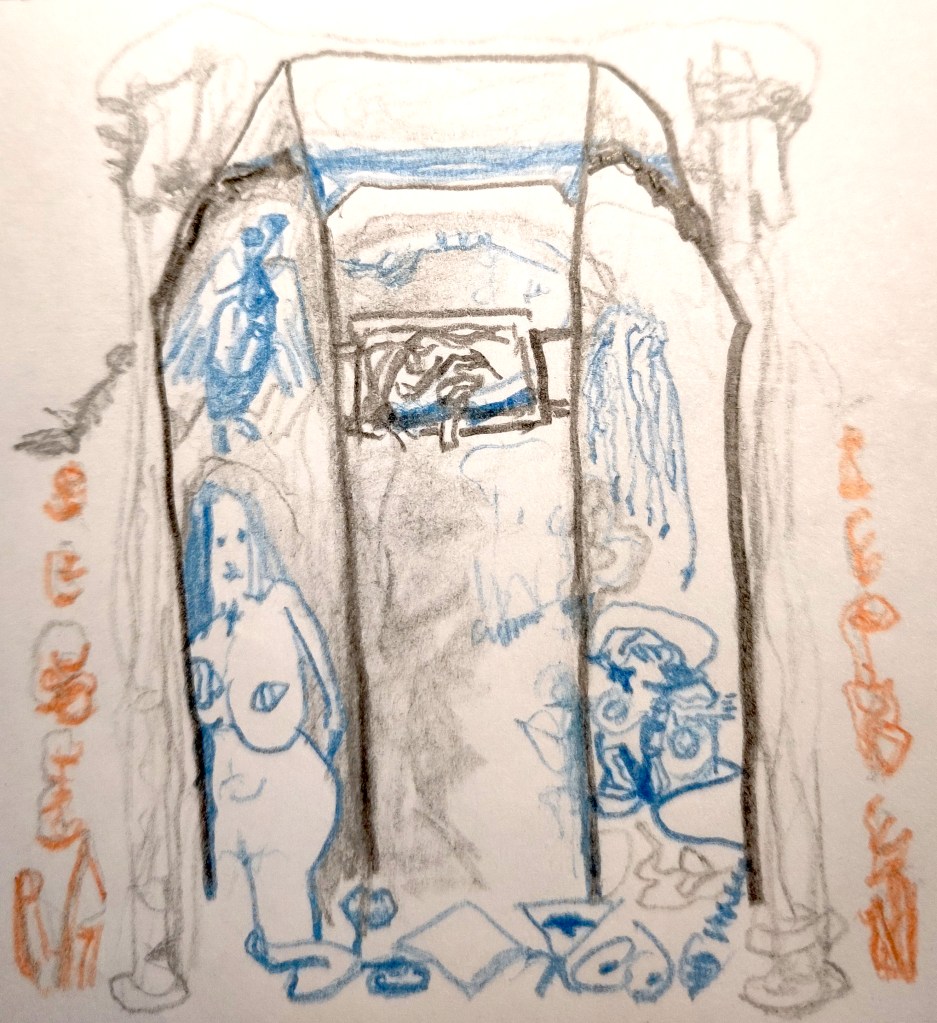
féminisme

Brunnen der Frauen

Im Eck ich steh, ich tu ihm weh – wer bin ich?
Gleich wird es hier so persönlich, dass ich keine Zeugen gebrauchen kann. Ich muss mit dem Gegenstand meiner Auseinandersetzung allein sein, weshalb ich ihn direkt ansprechen werde. Achtung, ich spreche: Wie – frage ich dich – soll es zwischen uns weitergehen? Was für Qualen gedenkst du mir weiter zu bereiten, die ich nicht entweder schon kennen oder aber mit endgültiger Trennung von dir beantworten würde?
Ach guck mal, die Wahrheitsdrohne schwirrt ab. Ernsthafte Beziehungsarbeit ist nicht so ihr Ding, scheints. Weiterlesen
Terrorballade
Mittwoch, 07. Februar 2024, 15 – 16 Uhr
Wortwellen – Radio X Live Stream
Zweimal hat das Wiesbadener Autorenehepaar Mara und Alexander Pfeiffer 2023 durch die WortWellen geführt, nun kehren die beiden mit seinem neuen Krimi „Terrorballade“ an die Mikrofone zurück. Im Roman soll Hauptfigur Sänger, Film-Nerd und Privatdetektiv wider Willen, einer alten Bekannten helfen und ihre einstige Liebe Robert Zimmermann finden. Was das mit der letzten RAF-Generation, Dashiell Hammett, Bob Dylan oder Filmen wie „Soul Kitchen“ und „The Big Lebowski“ zu tun hat, erörtern die Pfeiffers ebenso wie die Frage, wie Leben und Schreiben ineinandergreifen oder ob sich beides überhaupt trennen lässt. Den passenden Soundtrack zur Sendung hat Alexander Pfeiffer ausgesucht.
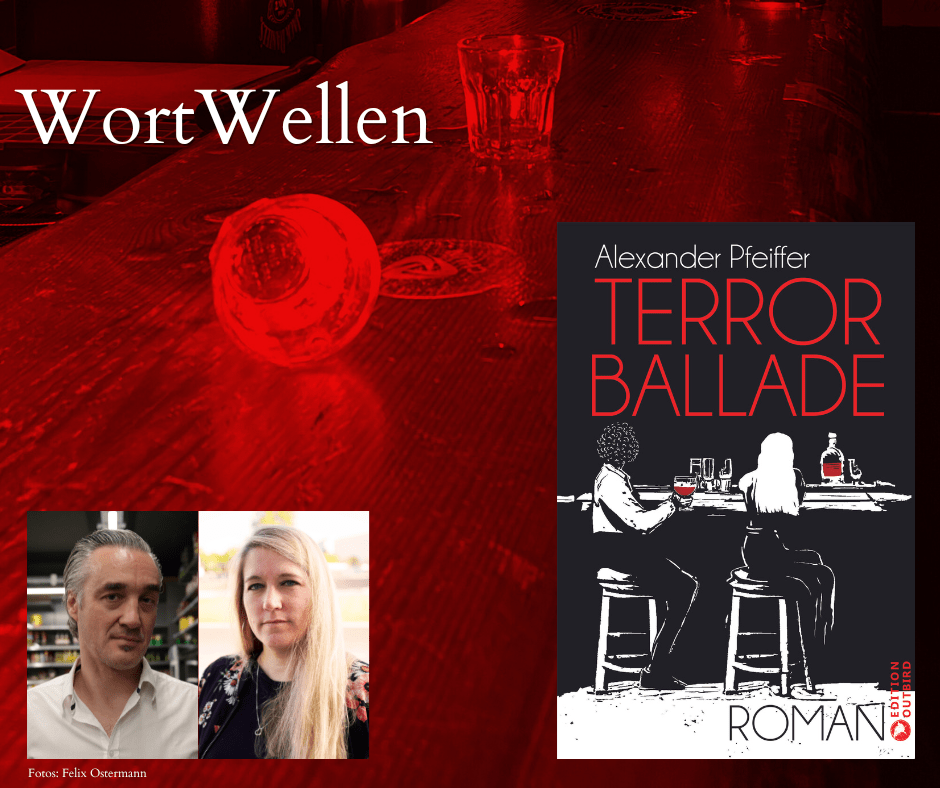
schön dich zu sehn

Stimmleere
Der leere Koffer am Boden
hält sein Maul
Über die Bettdecke
ist ein schweigendes Lächeln gezeichnet
Am Fenster nickt
der stille Vogel
am Himmel rollt
die sprachleere Wolke
die Finger ihres Schattens
streichen über das Dach
des Nachbarhauses
Joachim Durrang
Wünsche
Ist der Himmel grau
will ich ihn rot
Rollt eine Murmel über den Boden
erwarte ich einen Würfel
Joachim Durrang
Das Zerschreddern
In die Schreddermaschine sacken Briefe
häckseln zerstückelte Sätze
zersplittern fallende Grüße
und Beschreibungen
kurzer Augenblicke
in denen ich den Kopf an die Wand lehnte
Über meinen Blick glitten
Rhythmen und klirrende
Momente einer durchs Zimmer
schweifenden Musik
Joachim Durrang
Verlaufende Farben
Bilder meiner Pupillen
tropfen aufs Blatt Papier
laufen ineinander
Farben verschweben auf dem Zettel
aus einer wässrigen Lösung
malt sich ein Konsonant
sinkt ins Innere eines Vokals
Joachim Durrang
Amoris laetitia

Schuster, bleib bei unseren Flügeln
Es begab sich aber zur Weihnachtszeit, dass ich gen Frankfurt-Sachsenhausen radelte, um ein Geschenk zu kaufen. Kein Weihnachtsgeschenk, sondern ein Bild für eine der vielen Wände der Wohnung, die sich ein Freund gerade gekauft hat. Auf der Fechenheimer Fahrradbrücke erreichte mich der Anruf einer jungen Autorenkollegin, die ich in Sachsenhausen treffen wollte. Sie sei gerade in Fechenheim. Also verabredeten wir uns in einer kleinen Cafè-Galerie dortselbst.
Die Inhaberin hatte mich vor vielen Jahren zu einer Lesung eingeladen, seitdem nicht mehr gesehen. Nun wollte sie wissen, wie es mir in der Zwischenzeit ergangen sei. Weiterlesen
